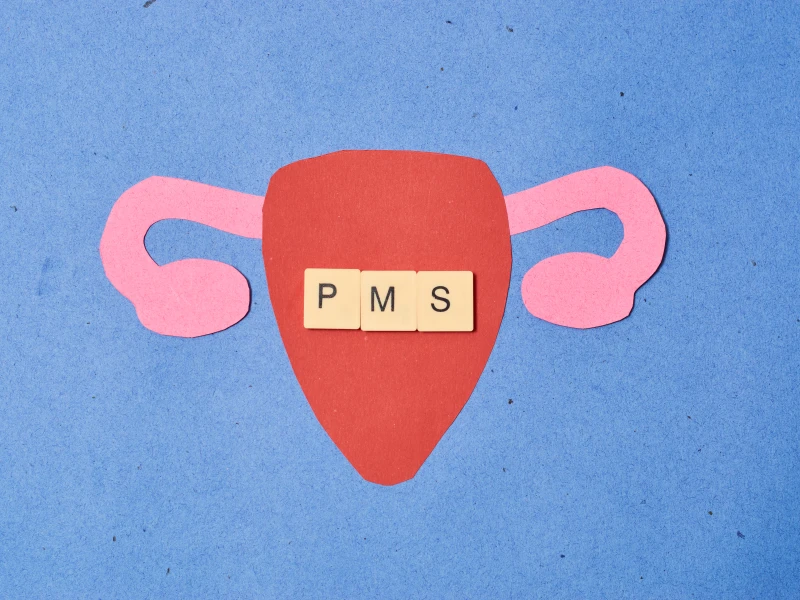Depressionen erblich? Gene, Umwelt & Cannabistherapie


In unserem Blog findest du Artikel zum Thema Medizinalcannabis bei verschiedenen Krankheitsbildern. Suche einfach einen Artikel unten – oder kontaktiere uns, wenn du noch weitere Artikel zu einem bestimmten Thema bekommen möchtest - oder schreibe dich in unserem Newsletter ein, um benachrichtigt zu werden, wenn es neue Artikel gibt.
Der Artikel auf einen Blick
- Genetische Veranlagung: Depressionen haben eine moderate Erblichkeit; Studien schätzen sie auf etwa 37 %, doch der überwiegende Teil des Risikos wird durch Umweltfaktoren bestimmt .
- Gene sind keine Bestimmung: Viele verschiedene Genvarianten tragen jeweils nur minimal zum Gesamtrisiko bei; ein einzelnes „Depressions‑Gen“ gibt es nicht .
- Endocannabinoid‑System verstehen: Das körpereigene System mit CB1‑ und CB2‑Rezeptoren reguliert Stimmung und Stress; Tierversuche zeigen, dass ein Mangel an CB1 zu depressionsähnlichen Verhaltensweisen führen kann .
- Cannabisblüten als Option: Medizinische Cannabisblüten aus der Apotheke können bei einigen Patient:innen depressive Symptome lindern, doch die Evidenz ist begrenzt und die Wirkung individuell; ein Forschungsteam fand in einer Studie mit Krebspatient:innen keine klare Dosis‑Wirkungs‑Beziehung von THC und CBD auf depressive Symptome .
- Sicherheit zuerst: Cannabinoid‑Therapie sollte immer ärztlich begleitet werden; Studien berichten bei höheren THC‑Dosen über Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel oder euphorische Zustände .
Worum es geht
Viele Menschen fragen sich, ob Depressionen erblich sind und was die Gene damit zu tun haben. In einer Zeit, in der psychische Erkrankungen offen diskutiert werden und moderne Therapieansätze wie medizinisches Cannabis zunehmend Beachtung finden, ist es wichtig, Fakten von Mythen zu trennen. Dieser Artikel führt dich durch die komplexe Welt der genetischen Veranlagung, erklärt, warum nicht nur Gene das Risiko bestimmen, und zeigt, wie das Endocannabinoid‑System als natürlicher Schaltkreis für unsere Stimmung wirkt. Du lernst, was medizinische Cannabisblüten aus der Apotheke sind, wie sie angewendet werden und welche realistischen Erwartungen du an eine solche Therapie haben kannst. Ein besonderes Anliegen ist es uns, dir Hoffnung zu geben, ohne unrealistische Versprechen zu machen – denn jedes Leben und jede Depression ist einzigartig.
Was du nach dem Artikel weißt / kannst
- du verstehst, wie Gene und Umwelt gemeinsam das Risiko für Depressionen formen und warum „vererbbar“ nicht mit unvermeidlich gleichzusetzen ist.
- du kennst wichtige Genvarianten und weißt, warum ihre Einzelwirkung klein ist.
- du hast einen Überblick über das Endocannabinoid‑System und die Unterschiede zwischen THC und CBD.
- du erfährst, wie medizinische Cannabisblüten eingesetzt werden können, welche Studien es dazu gibt und wie du realistische Erwartungen behältst.
- du bekommst einen praktischen Leitfaden, wie du legal und sicher Cannabispatient:in werden kannst.

Wie vererbbar ist Depression wirklich?
Wenn in der Familie Depressionen bekannt sind, taucht schnell die Frage auf: Ist Depression erblich? Forschende nutzen Zwillings‑, Familien‑ und Genomstudien, um diese Frage zu beantworten. Ein Meta‑Analyse von Familien‑ und Zwillingsstudien fand eine Heritabilität von rund 37 % (95 %-Konfidenzintervall 31–42 %) . Das bedeutet, dass etwa ein Drittel der Risiko‑Variation auf genetische Unterschiede zurückgeht. Gleichzeitig zeigen Daten aus großen Biobanken, dass mehr als die Hälfte des Risikos durch Umweltfaktoren wie Stress, Trauma oder Lebensstil bedingt ist . Die Gene schaffen also nur die Ausgangssituation – der entscheidende Anteil wird vom Lebensumfeld geprägt.
Unterschiede zwischen Frauen und Männern
Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Erblichkeit bei Frauen etwas höher sein kann als bei Männern. Eine große Studie mit 1,7 Millionen Zwillings‑ und Geschwisterpaaren fand, dass genetische Effekte bei beiden Geschlechtern weitgehend geteilt werden (genetische Korrelation 0,89) und die Unterschiede eher gering sind . Dennoch berichten einzelne Studien, dass rezidivierende oder frühe Depressionen in Familien stärker gehäuft auftreten als einmalige oder spätere Episoden . Die Botschaft bleibt: Gene beeinflussen das Risiko, aber sie diktieren nicht die Zukunft.
Genetik vs. Umwelt: ein Zusammenspiel
Es ist wichtig zu verstehen, dass Veranlagung und Erfahrung Hand in Hand gehen. Stressvolle Lebensereignisse, Kindheitstraumata, chronische Krankheiten oder sozialer Druck können bei Menschen mit genetischer Anfälligkeit leichter eine depressive Episode auslösen. In gut dokumentierten Fällen lässt sich bei etwa der Hälfte der Betroffenen ein auslösendes Ereignis identifizieren . Studien zeigen zudem, dass Polygenic‑Risk‑Scores (Summen aus vielen kleinen genetischen Effekten) vor allem dann aussagekräftig sind, wenn sie mit Informationen über Umweltbelastungen kombiniert werden . Praktisch heißt das: Auch wenn in deiner Familie Depressionen vorkommen, kannst du durch gesunden Lebensstil, soziale Unterstützung und professionelle Begleitung viel tun, um dein Risiko zu senken.
Welche Gene sind mit Depressionen verbunden?
Forscher:innen haben bisher hundert verschiedene Gene untersucht, die potenziell mit Depressionen in Verbindung stehen. Ein systematischer Review identifizierte 13 Gene, deren Polymorphismen (kleine Varianten in der DNA) häufiger bei Menschen mit Depression vorkommen . Dazu gehören SLC6A4 (ein Transporter für Serotonin), BDNF (wichtig für Nervenzellwachstum), COMT (ein Enzym im Dopaminstoffwechsel) und APOE (beteiligt am Fettstoffwechsel). Allerdings sind diese Effekte gering: Selbst häufige Varianten erhöhen das Risiko nur minimal und sind ohne Umweltfaktoren kaum aussagekräftig . Moderne Genome‑wide‑Association‑Studien (GWAS) identifizieren dutzende Risikoloci, doch keine einzelne Mutation ist notwendig oder hinreichend für die Erkrankung . Die wichtigsten Erkenntnisse sind deshalb: Es gibt kein einzelnes Depressions‑Gen, und genetische Tests allein können das Risiko nicht verlässlich vorhersagen.
CNR1, CNR2 und das Endocannabinoid‑System
Neben Serotonin‑ und Dopamingenen rücken auch CNR1 und CNR2 – Gene für die Cannabinoid‑Rezeptoren CB1 und CB2 – in den Fokus. Manche Studien fanden, dass bestimmte Varianten im CB1‑Gen (CNR1) häufiger bei Menschen mit Depression auftreten und möglicherweise die Reaktion auf Antidepressiva beeinflussen . Andere Arbeiten sehen einen Zusammenhang zwischen CB2‑Varianten und einer erhöhten Stress‑Empfindlichkeit . Doch die Ergebnisse sind widersprüchlich, und jüngere Meta‑Analysen finden keine konsistente Assoziation . Klar ist: Diese Gene allein erklären nicht, ob jemand erkrankt – sie können höchstens das Zusammenspiel mit Umweltfaktoren modulieren.
Endocannabinoid‑System: Der körpereigene Stimmungsregler
Das Endocannabinoid‑System (ECS) ist ein Netzwerk aus körpereigenen Botenstoffen (Endocannabinoiden), Rezeptoren und Enzymen. Die wichtigsten Endocannabinoide heißen Anandamid und 2‑Arachidonoylglycerol (2‑AG). Sie binden an CB1‑Rezeptoren, die vor allem im Gehirn vorkommen, und an CB2‑Rezeptoren, die im Immunsystem und peripheren Geweben angesiedelt sind. CB1 ist der am häufigsten vorkommende G‑Protein‑gekoppelte Rezeptor im Gehirn . Tierversuche zeigen, dass CB1‑Knock‑out‑Mäuse depressiv wirkende Verhaltensweisen zeigen und weniger Antrieb haben . Umgekehrt führen moderate CB1‑Aktivierungen durch Agonisten zu antidepressiven und anxiolytischen Effekten . Allerdings sind diese Effekte biphasisch: Hohe Dosen können Angst und Unwohlsein auslösen, während niedrigere Dosen beruhigen . Der CB2‑Rezeptor könnte ebenfalls eine Rolle in der Depression spielen, insbesondere im Zusammenhang mit Entzündungen , doch dazu wird noch geforscht.
THC, CBD und Terpene – die Wirkstoffe erklärt
THC (Tetrahydrocannabinol)
THC ist die vorherrschende psychoaktive Substanz in Cannabis. Sie bindet vor allem an CB1‑Rezeptoren und kann Euphorie, Entspannung, aber auch Angst oder Unruhe auslösen. Studien zeigen, dass THC den Amygdala‑Reaktionspegel reduziert, was als angstlösend interpretiert wird . Gleichzeitig kann intravenös verabreichtes THC psychotische Symptome hervorrufen . Bei oraler Gabe entsteht ein stärkeres Stoffwechselprodukt (11‑Hydroxy‑THC), das länger wirkt . Daher ist eine ärztliche Dosierung entscheidend, um unerwünschte Effekte wie Herzrasen, Schwindel oder Müdigkeit zu minimieren .
CBD (Cannabidiol)
CBD wirkt nicht psychoaktiv, hat eine geringe Bindungsaffinität zu CB1/CB2 und fungiert als negativer allosterischer Modulator . In Studien wirkt CBD anxiolytisch und leicht antidepressiv, wobei die Wirkung individuell sehr unterschiedlich ist. Eine Studie mit Krebspatient:innen zeigte, dass höhere CBD‑Dosen mit größerer Verbesserung der Angst verbunden waren, während kein klarer Zusammenhang mit depressiven Symptomen gefunden wurde . CBD wird oft gut vertragen, kann aber Müdigkeit oder gastrointestinale Effekte hervorrufen .
Terpene
Terpene sind aromatische Verbindungen, die den Geruch und Geschmack von Cannabisblüten prägen. Sie interagieren mit Cannabinoiden und könnten den sogenannten Entourage‑Effekt beeinflussen, also die modulierende Wirkung des gesamten Pflanzenprofils. Beispiele sind Myrcen (erdig, entspannend), Limonen (zitronig, stimmungsaufhellend) oder Linalool (lavendelartig, beruhigend). Auch hier gilt: Wirkungen sind individuell und wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden.

Können Cannabisblüten depressive Symptome lindern?
In Deutschland dürfen Cannabisblüten in Apotheken nur auf ärztliches Rezept abgegeben werden. Sie werden in Qualitätssicherungslaboren geprüft und bestehen aus getrockneten Blüten mit definiertem THC‑/CBD‑Gehalt. Die Anwendung erfolgt meist über einen Vaporizer, der die Wirkstoffe schonend erhitzt und inhaliert, ohne die Blüten zu verbrennen.
Was sagt die Forschung?
Die wissenschaftliche Evidenz für eine antidepressiv wirkende Cannabistherapie ist noch dünn. Ein Scoping‑Review über randomisierte, kontrollierte Studien fand nur eine einzige zwölfwöchige Studie, in der CBD als Zusatztherapie untersucht wurde; das Ergebnis: Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen CBD und Placebo in der Depressionsbewertung . Eine andere Untersuchung mit über 6 000 Krebspatient:innen beobachtete, dass depressive Symptome im Verlauf einer medizinischen Cannabistherapie im Durchschnitt um 25,6 % sanken, jedoch zeigte sich kein klarer Zusammenhang zwischen der Höhe der THC‑ oder CBD‑Dosis und der Verbesserung . Verbesserungen traten eher bei enteral (oral) applizierten Produkten auf, insbesondere wenn zusätzlich topische Präparate verwendet wurden .
Grenzen der Evidenz
Die bislang verfügbaren Studien sind klein, heterogen und oft kurz. Ein aktuelles Review betont, dass die Beweislage begrenzt ist und die Effekte von THC eher mit Nebenwirkungen assoziiert werden, während CBD teilweise moderate Verbesserungen zeigt . Adverse Events wie Müdigkeit, Schwindel, Somnolenz, trockener Mund oder psychoaktive Effekte traten bei hohen THC‑Dosen häufiger auf . Daher ist die Cannabistherapie bei Depressionen keine Routine‑Behandlung und sollte nur im Rahmen einer ärztlichen Begleitung versucht werden. Das Ziel ist Symptomlinderung, nicht Heilung, und die optimale Sorte, Dosierung und Einnahmeform werden individuell ermittelt.

Warum trotzdem Cannabisblüten ausprobieren?
Für Patient:innen, bei denen herkömmliche Therapien (Medikamente, Psychotherapie) wenig helfen oder erhebliche Nebenwirkungen verursachen, können Cannabisblüten eine ergänzende Option sein. Viele Betroffene berichten, dass sie besser schlafen, sich entspannter fühlen und ihre Alltagsbelastungen leichter bewältigen. Auch wenn diese Erfahrungsberichte keine wissenschaftlichen Beweise ersetzen, können sie in einem integrativen Therapieplan wertvoll sein. Wichtig ist, dass sich Patient:innen nicht selbst medikamentieren, sondern unter ärztlicher Anleitung langsam die passende Sorte und Darreichungsform finden. Dabei werden Faktoren wie THC‑/CBD‑Verhältnis und Terpenprofil berücksichtigt. Das Gefühl eines leichten „High“ ist nicht der Zweck der Therapie, sondern eine mögliche Begleiterscheinung, die durch die Auswahl von Sorten mit höherem CBD‑Anteil minimiert werden kann.
Sicherheit und mögliche unerwünschte Effekte
Wie bei jeder Arznei können auch bei medizinischen Cannabisblüten unerwünschte Wirkungen auftreten. Eine Übersichtsarbeit zu randomisierten Studien stellt fest, dass Cannabisprodukte im Allgemeinen gut vertragen wurden, Nebenwirkungen jedoch abhängig von Dosis und THC‑Gehalt variieren . Häufig genannte Effekte sind:
- Müdigkeit und Schläfrigkeit – insbesondere bei höheren THC‑Dosierungen.
- Schwindel oder leichtes Benommenheitsgefühl.
- Trockener Mund und Mundschleimhautreizung.
- Kognitive Veränderungen wie kurze Konzentrationsschwäche.
- Psychoaktive Effekte wie leichtes „High“ oder kurzfristige Euphorie bei THC‑reichen Sorten.
Seltenere, aber relevante Effekte sind ängstliche Gefühle, Herzrasen oder Kreislaufbeschwerden, vor allem bei Menschen mit niedriger Toleranz. Wichtig: Cannabis kann mit anderen Medikamenten interagieren (z.B. Gerinnungshemmern), weshalb du deine ärztliche Betreuung stets über alle Präparate informieren solltest. Eine Dosisanpassung erfolgt schrittweise („Start low, go slow“), um die beste Verträglichkeit zu erreichen.
Schritt‑für‑Schritt: So wirst du Cannabispatient:in
Medizinische Cannabisblüten sind in Deutschland verschreibungspflichtig und werden sorgfältig überwacht. Wenn du glaubst, dass diese Therapie für dich infrage kommt, kannst du dich an qualifizierte Ärzt:innen wenden. Der Prozess lässt sich in drei einfache Schritte aufteilen:
- Online‑Videosprechstunde vereinbaren: Suche einen Arzt oder eine Ärztin mit Erfahrung in der Cannabistherapie. Viele Praxen bieten inzwischen Videosprechstunden an. Halte vor dem Termin deine Krankengeschichte, aktuelle Medikamentenliste und vorhandene Arztbriefe bereit. Der Arzt nimmt sich Zeit, deine Beschwerden, bisherigen Therapien und Erwartungen zu besprechen. Du kannst offene Fragen stellen und gemeinsam klären, ob eine Cannabistherapie sinnvoll ist.
- Ärztliche Anamnese & individueller Therapieplan: In einem ausführlichen Gespräch erstellt der Arzt eine Anamnese. Er prüft, ob eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt und ob andere Therapien ausgeschöpft sind. Falls medizinisch angezeigt, erstellt er einen Therapieplan mit der geeigneten Sorte (THC‑/CBD‑Verhältnis, Terpenprofil) und der empfohlenen Darreichungsform (meist Vaporizer, gelegentlich Extrakte). Ein Rezept wird nur ausgestellt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und keine Kontraindikationen bestehen.
- Rezept in der Apotheke einlösen: Mit dem Rezept kannst du die verschriebene Sorte in einer Apotheke beziehen. Die Apotheke berät dich zur Lagerung, zum Mahlen und zur Anwendung im Vaporizer. Viele Apotheken bieten auch eine diskrete Versandoption. Sollte die Sorte einmal nicht verfügbar sein, klärt dein Arzt, ob eine vergleichbare Alternative infrage kommt. Bei Fragen zu Wirkung oder Nebenwirkungen steht dir der Arzt weiterhin zur Seite.
Häufige Fragen zum Einstieg
Ist Depression vererbbar?
Wie beschrieben, liegt die Heritabilität von Depressionen bei rund 37 % . Das bedeutet, dass genetische Faktoren das Risiko erhöhen können, aber die meisten Fälle sind durch Umwelt‑ und Lebensstilfaktoren geprägt . Eine familiäre Vorbelastung ist ein Hinweis, aber kein unausweichliches Schicksal.
Macht mich medizinisches Cannabis high?
Medizinische Cannabisblüten enthalten unterschiedlich viel THC und CBD. Sorten mit hohem THC‑Gehalt können ein leichtes High auslösen, doch das ist nicht das Ziel der Therapie. Ärzt:innen wählen Sorten mit ausgeglichenem oder höherem CBD‑Anteil aus, um psychoaktive Effekte zu reduzieren. Die Dosierung wird langsam gesteigert, damit du die Wirkung im Alltag gut verträgst .
Wie fühlt sich der Start an?
Die ersten Anwendungen erfolgen meist mit geringen Dosen über einen Vaporizer. Viele Patient:innen berichten von einer sanften Entspannung, verbesserter Schlafqualität und reduzierter Schmerzwahrnehmung. Manche fühlen sich in den ersten Tagen etwas schläfrig oder spüren einen trockenen Mund. Solche Effekte lassen sich meist durch Anpassung der Dosis oder der Sorte verringern und klingen nach einiger Zeit ab. Wichtig ist, dass du deinen Arzt über alle Veränderungen informierst.
Kann jeder Cannabisblüten verschrieben bekommen?
Nein. Die Verordnung richtet sich an Patient:innen mit schweren Erkrankungen, bei denen etablierte Therapien nicht ausreichend wirken oder mit starken Nebenwirkungen verbunden sind. Dazu zählen chronische Schmerzen, Spastiken, bestimmte psychiatrische oder neurologische Erkrankungen und Begleiterscheinungen schwerer körperlicher Krankheiten. Depressionen allein sind häufig kein anerkannter Hauptindikationsgrund, doch sie können im Rahmen komplexer Krankheitsbilder berücksichtigt werden. Letztlich entscheidet die Ärztin oder der Arzt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der individuellen Situation.
Fazit – Gene, Umfeld und Hoffnung auf Therapie
Depressionen sind komplexe Störungen, bei denen Gene, Umwelt und Persönliches Erleben ineinander greifen. Die Forschung zeigt, dass die Erblichkeit bei etwa einem Drittel liegt und zahlreiche Genvarianten jeweils nur einen kleinen Teil zum Risiko beitragen . Gleichzeitig machen Stress, Traumata und soziale Bedingungen mehr als die Hälfte des Gesamtbildes aus . Das bedeutet: Auch mit familiärer Vorbelastung hast du viele Möglichkeiten, präventiv aktiv zu werden und Unterstützung zu suchen.
Das Endocannabinoid‑System spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation von Stimmung und Stress. Vor allem CB1‑Rezeptoren können – je nach Aktivierung – stimmungsaufhellend oder angstfördernd wirken . Medizinische Cannabisblüten greifen in dieses System ein und können bei einigen Patient:innen Symptome lindern. Die Evidenz ist jedoch begrenzt; randomisierte Studien zeigen bislang keine klaren Vorteile gegenüber Placebo , und Verbesserungen sind individuell verschieden . Wer eine Cannabistherapie erwägt, sollte sie als ergänzenden Baustein sehen, nicht als Heilmittel. Wichtig sind eine sorgfältige ärztliche Begleitung, realistische Erwartungen und Geduld beim Finden der passenden Sorte und Dosierung.
Zum Schluss: Lass dich von genetischen Risiken nicht entmutigen. Du hast die Möglichkeit, durch gesunde Lebensgewohnheiten, professionelle Hilfe und – wenn angemessen – innovative Therapien wie medizinische Cannabisblüten dein Wohlbefinden zu verbessern. Offenheit, Wissen und Selbstfürsorge sind die Schlüssel zu einem besseren Umgang mit Depressionen.
Wir klären deine offenen Fragen
Lass uns deine Fragen beantworten
Wir nehmen uns Zeit für deine Fragen
Alle Antworten auf deine Fragen
Du hast Fragen oder suchst Rat zu Medizinalcannabis? Wir bringen Licht ins Dunkle und begleiten dich auf dem Weg zu mehr Gesundheit. Kontaktiere uns – wir sind für dich da.
Unsicherheiten bei einer neuen Therapie sind völlig normal. Wir nehmen uns Zeit für deine Bedenken und unterstützen dich dabei, die richtige Entscheidung für deine Gesundheit zu treffen.
Jede Entscheidung für eine neue Therapie braucht Vertrauen. Deshalb beantworten wir gerne alle deine Fragen rund um Medizinalcannabis - persönlich und ohne Zeitdruck.
Du fragst dich, ob Cannabis auch bei deinen Beschwerden helfen kann? Wir klären gemeinsam, welche Möglichkeiten sich für dich eröffnen und wie der Weg zu deiner optimalen Behandlung aussieht.
Vielen Dank!
Wir werden uns in kürze bei Ihnen melden.
Andere Artikel
Alle Artikel ansehenNoch Fragen?
Wir sind für dich da.
33100 Paderborn
medical@420pharma.deZum Kontaktformular